6.6 Kritische Betrachtung, Ausblick
Abschließend möchte ich die von mir durchgeführte Untersuchung kurz einer kritischen Betrachtung unterziehen, um somit gleichzeitig einen Ausblick auf die Bereiche zu geben, die in nachfolgenden Untersuchungsreihen meiner Meinung nach genauer erforscht werden sollten.
Zunächst muß natürlich davor gewarnt werden, die zuvor referierten Befunde - allein ihrer Signifikanz wegen - überzubewerten, da die Untersuchungsreihe dafür mit nur 28 Versuchspersonen ein wenig zu knapp bemessen war. Erst die Absicherung durch eine größere Untersuchungsgruppe kann die festgestellten Auffälligkeiten zusätzlich erhärten.
Eine weitere Einschränkung stellt die in der Regel nicht in meinem Beisein durchgeführte Sceno-Testuntersuchung dar, so daß ein Großteil von Informationen naturgemäß verlorengegangen ist. Dazu gehören insbesondere die Protokollierung des Spielverlaufs und die im Rahmen meiner Untersuchung nur zum Teil vorliegenden Ergebnisse der nachfolgenden Befragung, aus denen sich ebenfalls wertvolle Erkenntnisse (Bevorzugung / Vernachlässigung von Materialien, Umbauten, etc.) gewinnen lassen.
Ein technisches Problem in meiner Untersuchung war die Schwierigkeit, anhand der mir vorliegenden Polaroid-Fotos, die dargestellte Szene realitätsgetreu nachzubauen. Zumal mir nicht in jedem Fall der entsprechende, zum Zeitpunkt der Untersuchung verwendete Sceno-Testkasten zur Verfügung stand. Dadurch war ich gezwungen, kleinere Unterschiede in der Ausführung, beziehungsweise bei den einzelnen Materialien in Kauf zu nehmen. Zu einer Relativierung der referierten Ergebnisse trägt vermutlich auch die nicht immer gewährleistete Vollständigkeit der Sceno-Testkästen zum Zeitpunkt der Untersuchung bei. Zum Teil wurden die Sceno-Testkästen schon durch andere ergänzt oder "überbestückt", was z.B. das Auftreten zweier Kühe beim Sceno-Testschlußbild der Vp. 4 erklärt. Die Tatsache, daß nicht jede Versuchsperson den exakt gleichen Sceno-Testkasten mit identischer Bestückung für die Untersuchung zur Verfügung gestellt bekam, schränkte die Durchführungsobjektivität und damit die Beweiskraft der Ergebnisse weiter ein.
Das methodisch gravierendste Problem meiner Untersuchung war allerdings die fehlende Kontrollgruppe. Die Hilfskonstruktion, meine Ergebnisse mit den Ergebnissen der Kontrollgruppen aus anderen Untersuchungen zu vergleichen, führte zu dem Problem, daß kein vollständiger Vergleich mit den von mir aufgestellten Spielmerkmalen möglich war. Dieses Manko kann unter Umständen dafür verantwortlich sein, daß die Aussagekraft einiger weniger auswertbarer Spielmerkmale überbewertet wurde, da eine Relativierung durch die verbleibenden Spielmerkmale zum gleichen Themenkomplex nicht möglich war. Zusätzliche Probleme bereiteten in diesem Zusammenhang die in einigen Fällen auseinanderklaffenden Definitionen einzelner Spielmerkmale; insbesondere aber die Frage, welche Sceno-Testgestaltungen unter die entsprechenden Spielmerkmale zu subsumieren sind. Eine besondere Schwierigkeit ergab sich bei der Beurteilung der formalen Spielmerkmale, da eine eindeutige Zuordnung - mangels entsprechend klarer und eindeutiger Definitionen mit Ausschlußkriterien - nicht in jedem Fall gewährleistet war. Dieses zieht natürlich eine Einschränkung der Auswertungsobjektivität nach sich. Trotz der angebrachten Kritik hat sich meiner Meinung nach aber dennoch bestätigt, daß sich bei einer gewissenhaften Analyse der Sceno-Testgestaltungen wertvolle Hinweise - in Bezug auf die Ursachen der Störung und die damit verwobenen Probleme - gewinnen lassen. Eine Hauptaufgabe sollte es meiner Ansicht nach daher sein, in näherer Zukunft den vor Ort mit diesem Testverfahren arbeitenden Fachkräften endlich die dazu benötigten, klar formulierten Auswertungsschemata an die Hand zu geben. Diese sollten insbesondere die Bedeutung der bislang identifizierten Spielmerkmale, die Symbolgehalte einzelner Sceno-Materialien und Kontrollgruppenergebnisse einer psychisch unauffälligen Untersuchungsgruppe beinhalten. Für die Spielmerkmale sind dabei eindeutige Zuordnungs- und Ausschlußkriterien zu formulieren (ggf. durch Fotobeispiele). Nur so wird meines Erachtens der Grundstein für eine sachgerechte Interpretation der Testergebnisse gelegt. Gleichzeitig würde dabei der Gefahr einer unkorrekten Interpretation bestimmter Sceno-Testdarstellungen - in der Regel aus Unkenntnis - vorgebeugt.
7. Literaturverzeichnis
Abraham, K. (1961/62). Ergänzungen zur Lehre vom Analcharakter. Psyche, 15, 162 - 180.
Abrahams, D. (1963). Treatment of encopresis with
imipramine. The American Journal of Psychiatry, 119, 891 - 893.
Albrecht, H. & Hoffmann, H. (1950). Encopresis im Kindesalter. Der Nervenarzt, 21, 271 - 281.
Allesch, C. G. (1991). Über die Vorteile der Nachteile
projektiver Techniken. Diagnostica,
37, 93 - 96.
Altmann-Herz, U.
(1990). Zur Theorie und Praxis des Sceno-Tests. Acta Paedopsychiatrica, 53, 35 - 44.
American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3.ed., revised (DSM-III-R). American Psychiatric Association, Washington D.C. Deutsch: Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen (DSM-III-R). Deutsche Bearbeitung und Einführung von H.-U. Wittchen, H. Saß, M. Zautig & K. Koehler (1989). Weinheim: Beltz.
Amsterdam, B. (1979). Chronic Encopresis: A system based psychodynamic approach. Child
Psychiatry and Human Development, 9, 137 - 144.
Andolfi, M.
(1978). A structural approach to a family with an encopretic child. Journal of
Marriage and Family Counseling, 4, 25 - 29.
Anthony, E.
J. (1957). An experimental approach to the psychopathology of childhood: Encopresis.
The British Journal of Medical Psychology, 30, 146 - 175.
Arajärvi,
T. & Huttunen, M. (1971). Encopresis and Enuresis as symptoms of
depression. In: A.- L. Annell
(Ed.) Depressive states
in childhood and adolescence (pp. 212 - 217). New York: Halsted Press.
Artner, K & Castell, R. (1979). Stationäre Therapie von einkotenden Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 28, 119 - 132.
Artner, K. & Castell, R. (1981). Enkopresis - Diagnostik und stationäre Therapie. In: H. - C. Steinhausen (Hrsg.), Psychosomatische Störungen und Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen (S. 93 - 119). Stuttgart: Kohlhammer.
Ashkenazi, Z. (1975). The treatment of encopresis using a discriminative stimulus and positive
reinforcement. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 6, 155
- 157.
Asperger, H. (1980). Neuropathie, Psychopathie, Psychosen, psychogene Erkrankungen. In: E. Feer, G. Joppich, F. J. Schulte (Hrsg.), Lehrbuch der Kinderheilkunde (S. 695 - 710), Stuttgart: Fischer.
Ayllon, T.,
Simon, S. J., Wildman, R. W. (1975). Instructions and reinforcement in the
elimination of encopresis: A case study. Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 6, 235 - 238.
Baird, M.
(1974). Characteristic interaction patterns in families of encopretic children.
Bulletin of the Menninger Clinic, 38, 144 - 153.
Balson, P.
M. (1973). Case study: Encopresis: A case with symptom substitution? Behavior
Therapy, 4, 134 - 136.
Bätzel, R. (1981). Der Verlauf des Enkopresissyndroms untersucht anhand von Katamnesen. Dissertation, Wilhelms-Universität, Münster.
Baum, M. E. (1979). Encopresis in children. Nursing, 9, 11.
Beck, M. (1979). Die Betreuung eine enkopretischen Jungen in einer Erziehungsberatungsstelle. In: H. Mackinger (Hrsg.), Verhaltenstherapie in der klinischen Praxis (S. 78 - 96). Salzburg: Müller.
Bellman, M. (1966). Studies on encopresis. Acta Paediatrica Scandinavica, Supplement 170. Stockholm: N.O. Mauritzons Boktryckeri Ab.
Bellman, M. (1971). Encopresis/Enuresis and Depression:
Psychopathological Mechanisms. In: A. - L. Annell (Ed.), Depressive states in
childhood and adoloescence (S. 218 - 224). New York: Halsted Press.
Bemporad, J. R.
(1978). Encopresis. In
B. B. Wolman, Egan, J., Ross, A. O. (Eds.), Handbook of treatment of mental
disorders in childhood and adolesence (S. 161 - 178). Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall.
Bemporad, J. R., Pfeifer, C. M., Gibbs, L., Cortner, R. H.,
Bloom, W. (1971). Characteristics
of encopretic patients and their families. Journal of the American Acadamy of
Child Psychiatry, 10, 272 - 292.
Bemporad, J. R., Kresch, R. A., Asnes, R., Wilson, A.
(1978). Chronic neurotic encopresis
as a paradigm of a multifactorial psychiatric disorder. The Journal of Nervous
and Mental Disease, 166, 472 - 479.
Benady, D. R.
(1967). Encopresis. Developmental Medicine and Child Neurology, 9, 771 - 772.
Bender, T & Branik, E. (1992). Wechselwirkungen zwischen stationärer und ambulanter Psychotherapie am Beispiel einer sekundären Enkopresis in der Präadoleszenz. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 20, 147 - 154.
Berg, I.,
Forsythe, I., Holt, P., Watts, J. (1983). A controlled trial of ´senokot´ in
faecal soiling treated by behavioural methods. Journal of Child Psychology and
Psychiatry and allied Disciplines, 24, 543 - 549.
Berger, I. & Rennert, H. (1956). Untersuchungen mit dem Sceno-Test bei Enuresis und Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 5, 140 - 143.
Berger, M. (1974). Stationäre Behandlung eines sechsjährigen Einkoters. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 23, 5 - 11.
Berger, M. (1977). Zur Psychodynamik der Mutter-Kind-Beziehung bei psychosomatischen Erkrankungen von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Zeitschrift für Kinder- und Jugenpsychiatrie, 5, 151 - 164.
Berk, H. - J. (1992). Gestaltende Testverfahren. Eine Skizze zur Problematik des Begriffes "Projektive Testverfahren". Praxis der Forensischen Psychologie, 2 (1), 21 - 24.
Biermann, G. (1951/52). Einkotende Kinder. Psyche V, 618 - 627.
Biermann, G. (1953). Geständnis- und Wiederholungszwang im Sceno-Test. Zeitschrift für diagnostische Psychologie und Persönlichkeitsforschung, 3, 317 - 331.
Biermann, G. (1958). Die psychologische Situation jugendlicher Diebe und ihre Projektion im Scenotest. Zeitschrift für Kinderheilkunde, 81, 509 - 528.
Biermann, G. (1960). Die Bedeutung des Malens für die Diagnostik und Therapie der Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 9, 33 - 47.
Biermann, G. (1970). Diagnostische und therapeutische Möglichkeiten des Szenotestspieles. Archiv für Kinderheilkunde, 1, 63 - 76.
Biermann, G. & R. (1962). Das Szenotestspiel der Schizophrenen. Schweizer Archiv für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, 89, 97 - 169.
Binét, A. (1979). Zur Genese von Störungen der Sphinkterkontrolle. Psyche 33, 1114 - 1126.
Blöschel, L. (1966). Kullbacks 2î - Test als ökonomische Alternative zur Chi-Quadrat- Probe. Psychologische Beiträge, 9, 379 - 406.
Bosch, J.D. (1988). Enkopresis als Entwicklungsstörung. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 16, 155 - 162.
Brem-Gräser, L. (1986). Familie in Tieren. München: Reinhardt.
Brickenkamp, R. (1975). Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests. Göttingen: Hogrefe.
Bründel, H. (1991). Schulpsychologische und klinische Intervention bei Enuresis und Enkopresis. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 38, 51 - 58.
Bürgin, D. (1993). Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter. Stuttgart: Gustav Fischer.
Burns, C.
(1941). Encopresis (Incontinence of faeces) in children. British Medical Journal,
2, 767 - 769.
Butler, J. F. (1977). Treatment of encopresis by overcorrection. Psychological Reports, 40, 639 - 646.
Castell, R., Benka, G., Hoffmann, I. (1983). Prognose enkopretischer Kinder bei stationärer Behandlung. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 32, 93 - 95.
Coché, J. A. & Freedman, P. (1975). Behandlung eines Falles von Enkopresis durch Phantasietherapie in einer Gruppe von Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 24, 26 - 32.
Coekin, M. & Gairdner, D. (1960). Faecal incontinence in children. British
Medical Journal, 2, 1175 - 1180.
Collier, H.
L. (1974). Enuresis and Encopresis. In: W. G. Klopfer & M. R. Reed (Eds.),
Problems in psychotherapy: An eclectic approach (S. 97 - 106). New York: John
Wiley & Sons.
Crowley, C.
P. & Armstrong, P. M. (1977). Positive practice, overcorrection and behavior
rehearsal in the treatment of three cases of encopresis. Journal of Behavior
Therapy and Experimental Psychiatry, 8, 411 - 416.
Davidson,
M. (1958). Constipation and fecal incontinence. Pediatric Clinics of North America,
5, 749 - 757.
Davidson, M., Kugler, M. M., Bauer, C. H. (1963). Diagnosis and management in children
with severe and protracted constipation and obstipation. The Journal of Pediatrics,
62, 261 - 275.
Dold, P. (1989). Sceno-Familientherapie. München: Reinhardt.
Doleys, D. M., Mc Whorter, A. Q., Williams, S. C., Gentry, W. R. (1977). Encopresis: Its treatment and relation to nocturnal enuresis. Behavior Therapy, 8, 77 - 82.
Dorsch, F., Häcker, H., Stapf, K.- H. (1987). Psychologisches Wörterbuch. Bern: Huber.
Dreman, S. B. (1977). Secrecy, silk gloves and sanctions: A family approach to treating an
encopretic child. Family Therapy, 4, 171 - 177.
Dührssen, A. (1974). Psychogene Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Dunkell, S. V. (1954). An exploratory study of "Das Formale" (The Layout) in the Szeno-Test. Dissertation, Universität, Zürich.
Easson, W.
M. (1960). Encopresis -
psychogenic soiling. The
Canadian Medical Association Journal, 82, 624 - 628.
Edelman, R. I. (1971). Operant conditioning treatment of encopresis. Journal of Behavior
Therapy and Experimental Psychology, 2, 71 - 73.
Edgcumbe,
R. (1978). The psychoanalytic view of the development of encopresis. Bulletin
of the Hampstead Clinic, 1, 57 - 61.
Eller, H. (1960). Über die Enkopresis im Kindesalter. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 108, 415 - 421.
Enck, P., Kränzle, U., Schwiese, J., Dietz, M., Lübke, H. J., Erckenbrecht, J. F., Wienbeck, M., Strohmeyer, G. (1988). Biofeedback-Behandlung bei Stuhlinkontinenz. Deutsche Medizinische Wochenschrift, 113, 1789 - 1794.
Enders, U. & Stumpf, J. (1990). Die Narben des Mißbrauchs. In: U. Enders (Hrsg.), Zart war ich, bitter war´s (S. 75 - 88). Köln: Kölner Volksblatt.
Engel, B.T., Nikoomanesh, P., Schuster, M. M. (1974). Operant conditioning of rectosphincteric
responses in the treatment of fecal incontinence. The New England Journal of
Medicine, 290, 646 - 649.
Engels, H. (1957). Eine spezielle Untersuchungsmethode mit dem Sceno-Test (von Staabs Test) zur Erforschung der normalen kindlichen Persönlichkeit. Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung.
Erikson, E. H. (1984). Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart : Klett-Cotta.
Ermert, C. (1994). Spielverhalten im Scenotest. Bern : Huber.
Ermert, C., Fuhrmann, U., Sander, E. (1991). Schlußbildanalyse des Scenotestaufbaus. Empirische Pädagogik, 5 (4), 377 - 387.
Fisher, S. M. (1979). Encopresis. In : J. D. Noshpitz (Ed.), Basic handbook of child psychiatry
(S. 556 - 568). New York : Basic Books.
Fisseni, H.- J. (1990). Lehrbuch der psychologischen Diagnostik. Göttingen: Hogrefe.
Fitzgerald, J. F. (1975). Encopresis, soiling, costipation: What´s to be done? Pediatrics, 56, 348 - 349.
Freud, A. (1966). Einführung in die Technik der Kinderanalyse. München: Reinhardt.
Freud, A. (1968). Wege und Irrwege in der Kinderentwicklung. Bern: Huber.
Freud, S. (1972). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. In : Studienausgabe, Band 5. Frankfurt: Fischer.
Freud, S. (1973). Charakter und Analerotik. In : Studienausgabe, Band 7. Frankurt: Fischer.
Freud, S. (1980). Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. In : Studienausgabe, Band 1. Frankfurt: Fischer.
Freud, S. (1989). Abriß der Psychoanalyse. Das Unbehagen in der Kultur. Frankfurt: Fischer.
Fried, R. (1980). Familiale und soziale Ursachen der Enkopresis. Expertentreffen: Soziale Aspekte der geistig-emotionalen Behinderung von Kindern. Frankfurt/Main.
Fritz, G. K. & Armbrust, J. (1982). Enuresis and Encopresis. Psychiatric Clinic of
North America, 5, 283 - 296.
Gairdner,
D. (1965). Incontinence of urine or of faeces. British Medical Journal, 2, 91 -
94.
Geißler, W. (1985). Der Voraussagewert einer multiaxialen Diagnose für die spätere Sozialbewährung kindlicher Enkopretiker. Der Nervenarzt, 56, 275 - 278.
Gelber, H. & Meyer, V. (1965). Behaviour therapy and encopresis: The
complexities involved in treatment. Behaviour Research and Therapy, 2, 227 -
231.
Glanzmann, E. (1934). Zur Psychopathologie der Enkopresis. Zeitschrift für Kinderpsychiatrie, 1, 69 - 76.
Gött, H. (1959). Incontinentia alvi und Enkopresis im Kindesalter. Deutsche Medizinische Wochenschrift, 84, 112 - 115.
Graham, P.
(1991). Child Psychiatry. Oxford: Oxford University Press.
Granditsch, G., Wagner, I. U., Czerwenka-Wenkstetten, G. (1976). Überlaufenkopresis. Pädiatrie und Pädologie, 11, 261 - 267.
Gutezeit, G. (1983). Psychogene Störungen in der Entwicklung des Kindes. In: C. Simon (Hrsg.), Klinische Pädiatrie (S. 405 - 444). Stuttgart: Schattauer.
Gutzeit, L. M. (1961). Vergleich der diagnostischen Möglichkeiten beim Sceno-Test und beim Welt-Test. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 10, 87 - 93.
Harbauer, H. (1978). Das aggressive Kind. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 126, 472 - 478.
Harbauer, H. (1984). Kinder- und Jugendpsychiatrie. Köln: Deutscher Ärzte Verlag.
Harnack, G.-A. von & Wallis, H. (1954). Möglichkeiten und Grenzen der Anwendbarkeit des Scenotests. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 102, 503 - 508.
Hartmann, H.A., Haubl, R., Neuberger, O., Peltzer, U., Wakenhut, R. (1984). Diagnostische Probleme psychologischer Begutachtung. In: H. A. Hartmann & R. Haubl (Hrsg.), Psychologische Begutachtung (S. 75 - 126). München: Urban & Schwarzenberg.
Hasselmann, H. (1936). Über Enkopresis (Einkoten). Dissertation, Hohe Medizinische Fakultät, Leipzig.
Hennig, H. (1977). Einige Ergebnisse psychologischer Untersuchungen bei Enuretikern und Enkopretikern im Kindesalter. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, 71, 431 - 434.
Hennig, H., Gaitzsch, U., Dober, B. (1972). Ergebnisse katamnestischer Untersuchungen bei Enkopretikern im Kindesalter. Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie, 24, 355 - 363.
Herzka, H. S. (1978). Kinderpsychiatrische Krankheitsbilder. Stuttgart: Schwabe.
Hoag, J.
M., Norriss, N. G., Himeno, E. T., Jacobs, J. (1971). The encopretic child and
his family. Journal of the American Acadamy of Child Psychiatry, 10, 242 - 256.
Höhn, E. (1951). Entwicklungsspezifsche Verhaltensweisen im Sceno-Test. Zeitschrift für Psychotherapie und medizinische Psychologie, 1, 77 - 86.
Höhn, E. (1964). Spielerische Gestaltungsverfahren. In: R. Heiss (Hrsg.), Handbuch der Psychologie, Bd. 6: Psychologische Diagnostik (S. 685 - 705). Göttingen: Hogrefe.
Hörmann, H. (1964). Theoretische Grundlagen der projektiven Tests. In: R. Heiss (Hrsg.), Handbuch der Psychologie, Bd. 6: Psychologische Diagnostik (S. 71 - 112). Göttingen: Hogrefe.
Hürter, A. & Piske-Keyser, K. (1989). Das gemeinsame Muster physiologischer und beziehungsdynamischer Prozesse bei einer langjährigen Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 38, 171 - 177.
Huschka, M.
(1942). The child´s response to coercive bowel training. Psychosomatic Medicine, 4, 301 - 308.
Jaide, W. (1953). Alters- und geschlechtstypisches Verhalten im Scenotest ? Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 2, 291 - 297.
Jaide, W. (1956). Verhalten Pubertierender im Scenotest. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 5, 140 - 143.
Jones, E. (1919). Über analerotische Charakterzüge. Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, 5, 69 - 92.
Kächele-Seegers, B. M. (1969). Über die Bedeutung der Vulgärlösungen im Sceno-Test (Puppenspieltest) als Ausdruck des Sozialverhaltens neurotischer, verhaltensgestörter, psychosomatisch erkrankter und hirnorganisch geschädigter Kinder und Jugendlicher. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München.
Kadinsky, D. (1969). Enkopresis. In: G. Biermann (Hrsg.), Handbuch der Kinderpsychotherapie, Band 2 (S. 962 - 971). München: Reinhardt.
Katz, J. (1972). Enuresis and encopresis. The Medical Journal of Australia, 1, 127 - 130.
Keilbach, H. (1976). Aus der Behandlung eines achtjährigen Jungen mit Enkopresis acquisita als Hauptsymptomatik. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 25, 81 - 91.
Keilbach, H. (1977). Untersuchung an acht Kindern mit der Hauptsymptomatik Einkoten. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 26, 117 - 128.
Kemper, K. A. (1955). Widerspiegelung einer Kinderkurztherapie in der Scenodarstellung. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 4, 85 - 90.
Kettler, A. R. (1976). Psychoanalytische Therapie eines zehnjährigen Jungen ohne durchgehende Einbeziehung der Eltern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 25, 289 - 291.
Knehr, E. (1961). Konfliktgestaltung im Scenotest. München: Reinhardt.
Koch, M. (1955). Spieltests als Spiegel menschlicher Umwelten. Psychologische Rundschau, 6, 120 -126.
Körholz, G. (1951). Über die Anwendbarkeit des Scenotestes in der Kinderklinik. Zeitschrift für Kinderheilkunde, 69, 311 - 330.
Kratzky-Dunitz, M. & Scheer, P.J. (1988). Psychosomatische Aspekte der Enkopresis. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 136, 630 - 635.
Krisch, K.
(1979). Some somatic variables in encopretic children. International Journal of
Rehabilitation Research, 2, 521 - 522.
Krisch, K. (1980)1. Die stationäre Behandlung dreier Enkopretiker: Planung, Verlauf und Ergebnisse einer verhaltenstherapeutischen Intervention. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 29, 117 - 124.
Krisch, K. (1980)2. Eine vergleichende Untersuchung zum "Enkopretischen Charakter". Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 29, 42 - 47.
Krisch, K. (1981). Ein "Paradefall" von Enkopresis. Verhaltensmodifikation, 2, 183 - 194.
Krisch, K. (1982). Enkopresis als Schutz vor homosexuellen Belästigungen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 31, 260 - 265.
Krisch, K. (1985). Enkopresis. Bern: Huber.
Krisch, K. & Erhard, R. (1978). Einige kritische Überlegungen zur Verhaltenstherapie bei Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 26, 60 - 63.
Krisch, K. & Jahn, J. (1981). Anamnesedaten und Untersuchungsergebnisse von 36 Enkopretikern. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 9, 16 - 27.
Krolewski, R. (1984). Das einkotende Kind. Eine vergleichende Untersuchung über den familiären Hintergrund und die Scenotest-Gestaltungen von 60 Enkopretikern. Dissertation, Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn.
Kühnen, J. (1973). Das Formale im Scenotest. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München.
Largo, R. H & Stutzle, W. (1977). Longitudinal study of bowel and bladder control
by day and at night in the first six years of life. Developmental Medicine and
Child Neurology, 19, 598 - 606.
Largo, R. H., Gianciaruso, M., Prader, A. (1978). Die Entwicklung der Darm- und Blasenkontrolle von der Geburt bis zum 18 Lebensjahr. Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 108, 155 - 160.
Levine, M.
D. & Bakow, H. (1976). Children with encopresis: A study of treatment
outcome. Pediatrics, 58, 845 - 852.
Levine, M.
D., Mazonson, P., Bakow, H. (1980). Behavioral symptom substitution in children
cured of encopresis. American Journal of Diseases of Children, 134, 663 - 667.
Levowitz, H. J. & Goldstein, G. (1979). Encopresis in adolescence: Two case studies. Adolescence, 14, 297 - 311.
Liebe, S. (1949). Zur Pathogenese der Enkopresis. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 97, 49 - 52.
Loney, J.
(1971). Clinical Aspects of the Loney Draw-A-Car Test: Enuresis and encopresis.
Journal of Personality Assessment, 35, 265 - 274.
Lüpnitz, S. (1956). Der Scenotest als Mittel zur Erforschung der normalen kindlichen Persönlichkeit. Psychologische Rundschau, 7, 85 - 94.
MacNamara, M. (1965). Notes on a case of lifelong encopresis. The British Journal of Medical
Psychology, 38, 333 - 338.
McTaggart,
A. & Scott, M. (1959). A review of twelve cases of encopresis. Journal of
Pediatrics, 54, 762 - 768.
Melamed-Hoppe, M. (1969). Die Schlüsselsituation im Scenotest (Puppenspieltest) als Konflikt-Darstellung bei verhaltensgestörten, neurotischen, psychosomatisch erkrankten und organisch geschädigten Kindern und Jugendlichen. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München.
Meyerhoff, H. (1967). Katamnestische Untersuchungen bei Enkopresis. In: H. Stutte (Hrsg.), Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete (S. 71 - 76). Stuttgart: Huber.
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (1991). Was stimmt da nicht ? Bonn: Universitäts-Druckerei.
Moosmann, H. (1978). Das Schul-Sceno-Rollenspiel. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 27, 11 - 21.
Musiol, B. (1970). Ein Versuch der numerischen Bestimmung der Auswertungsobjektivität beim Scenotest (Staabstest). Dissertation, Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck.
Neale, D.
H. (1963). Behaviour therapy and encopresis in children. Behaviour Research and
Therapy, 1, 139 - 145.
Niedermeyer, K. & Parnitzke, K. H. (1963). Die Enkopresis. Zeitschrift für Kinderheilkunde, 87, 404 - 431.
Nissen, G. (1980). Psychische Entwicklung und ihre Störungen. In: H. Harbauer, R. Lempp, G. Nissen, P. Strunk (Hrsg.), Lehrbuch der speziellen Kinder- und Jugendpsychiatrie (S. 13 - 20). Berlin: Springer.
Nissen, G., Menzel, M., Friese, H.- J., Trott, G.- E. (1991). Enkopresis bei Kindern. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 19, 170 - 174.
Olatawura, M. O.
(1973). Encopresis. Acta Paediatrica Scandinavica, 62, 358 - 364.
Pervin, L. A. (1987). Persönlichkeitstheorien. München: Reinhardt.
Petermann, F. (Hrsg.) (1994). Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie. Göttingen: Hogrefe.
Poten, I. von (1952). Die Verwendung des Sceno-Tests zur tiefenpsychologischen Untersuchung des Kindes. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 100, 283 - 292.
Poten, I. von (1953). Die Beurteilung kindlicher Defektpersönlichkeiten mit Hilfe des Sceno-Tests. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 101, 189 - 190.
Prath, J. M. (1951). Ein Fall von Enkopresis. Zeitschrift für Kinderpsychiatrie, 18, 15 - 16.
Probst, P, Asam, U., Frantz, E. (1980). Eine Katamnesestudie zur psychosozialen Integration von Erwachsenen mit Enkopresis im Kindes- und Jugendalter. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 8, 135 - 149.
Rauchfleisch, U. (1992). Psychodynamische Theorie. In: R. S. Jäger & F. Petermann (Hrsg.), Psychologische Diagnostik (S. 79 - 89). Weinheim: PVU.
Reinhard, H. G. (1985). Zur Daseinsbewältigung bei Kindern mit Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 34, 183 - 187.
Rick, H. & Riedrich, F. W. (1978). Enkopresis bei zeitbegrenzt stationär betreuten Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 27, 109 - 116.
Ross, A. O. (1982). Psychische Störungen bei Kindern. Stuttgart: Hippokrates.
Salis, T. von (1975). Eine formale Analyse des Scenotest-Schlußbildes. Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen, 34, 68 - 89.
Salis, T. von & Preisig, M. (1978). Scenotest-Schlußbild. In: H. Städeli (Hrsg.), Die chronische Depression beim Kind und beim Jugendlichen (S. 119 - 120). Bern: Huber.
Schaefer, C. E. (1978). Treating psychogenic encopresis: A case study. Psychological Reports,
42, 98.
Schaengold,
M. (1977). The relationship between father-absence and encopresis. Child Welfare,
56, 386 - 394.
Schimon, K. (1962). Ein Fall von Einkoten. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 11, 130 - 138.
Schober, S. (1977). Einschätzung und Anwendung projektiver Verfahren
in der heutigen klinisch-psychologischen Praxis. Ergebnisse einer schriftlichen
Umfrage unter den Erziehungsberatern der BRD. Diagnostica, 23, 364 - 372.
Schwidder, W. (1975). Schriften zur Psychoanalyse der Neurosen und Psychosomatischen Medizin. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Scott, E.
A. (1977). Treatment of encopresis in a classroom setting: A case study. The
British Journal of Educational Psychology, 47, 199 - 202.
Shane, M.
(1967). Encopresis in a latency boy. The Psychoanalytic study of the child, 22,
296 - 314.
Shirley, H.
F. (1938). Encopresis in children. Journal of Pediatrics, 12, 367 - 380.
Sieberer-Kefer, A. (1979). Die Symbolik der Farbbausteine im Scenotest. Dissertation, Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität, Salzburg.
Silber, D. L. (1969). Encopresis: Discussion of etiology and management. Clinical Pediatrics,
8, 225 - 231.
Spitz, R.
A. & Wolf, K. M. (1949). Autoerotism: Some empirical findings and
hypotheses on three of its manifestations in the first year of life. This
Annual, 3/4, 85 - 120.
Staabs, G. von (1951). Der Scenotest. Stuttgart: Hirzel.
Staabs, G. von (1953). Der Scenotest in Diagnostik und Therapie. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 101, 182 - 185.
Staabs, G. von (1955). Der Sceno-Test (von Staabs-Test). In : E. Stern (Hrsg.), Die Tests in der Klinischen Psychologie (S. 686 - 697). Zürich: Rascher.
Staabs, G. von (1958). 3. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für stationäre Kinderpsychotherapie vom 24. bis 27. Mai in Berlin. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 7, 29 - 31.
Staabs, G. von (1969). Die Rolle des Scenotests in der Kinderpsychotherapie. In: G. Biermann (Hrsg.), Handbuch der Kinderpsychotherapie (S. 456 - 463). München: Reinhardt.
Stegat, H. (1975). Die Verhaltenstherapie der Enuresis und Enkopresis. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 3, 149 - 173.
Steinhausen, H. C. (1985). Enkopresis. In H. Remschmidt & M. H. Schmidt (Hrsg.), Kinder- und Jugendpsychiatrie in Klinik und Praxis Band III (S. 96 - 102). Stuttgart: Thieme.
Steinhausen, H. C. (1988). Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. München: Urban & Schwarzenberg.
Steinmüller, A. & Steinhausen, H. C. (1990). Der Verlauf der Enkopresis im Kindesalter. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 39, 74 - 79.
Stern, H. P., Prince, M. T., Stroh, S. E. (1988). Encopresis responsive to non-psychiatric interventions. Clinical Pediatrics, 8, 400 - 402.
Strunk, P. (1980). Enkopresis. In H. Harbauer, R. Lempp, G. Nissen, P. Strunk (Hrsg.), Lehrbuch der speziellen Kinder- und Jugendpsychiatrie (S. 192 - 196). Berlin: Springer.
Strunk, P. (1989) Enkopresis. In: C. Eggers, R. Lempp, G. Nissen, P. Strunk (Hrsg.), Kinder- und Jugendpsychiatrie (S. 255 - 258). Berlin: Springer.
Süssenbacher, G. (1986). Hilfreicher Dialog als strukturales Problem: Zur Übereinstimmung von Metapher und Affekt. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 35, 137 - 146.
Tatzer, E. & Schubert, M. T. (1983). Enkopresis - Somatische und psychische Faktoren in Diagnose und Therapie. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 11, 43 - 51.
Tinschmann, P. (1980). Obstipation, Enkoprese und proktologische Krankheiten. In: K. D. Bachmann, H. Ewerbeck, G. Joppich, E. Kleihauer, E. Rossi, G. R. Stalder (Hrsg.), Pädiatrie in Praxis und Klinik, Band II. Stuttgart: Fischer.
Trombini, G. (1970). Das Selbermachenwollen des Kindes im Bereich der Ernährung und Entleerung. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 19, 3 - 10.
Trott, G. E., Friese, H. J., Wirth, S., Nissen, G. (1994).
Diagnostik und Therapie der Enkopresis. Psycho, 20, 81 - 86.
Vaughan, G.
F. (1961). Costipation and encopresis: A childrens´s psychiatrist´s view. In :
R. MacKeith & J. Sandler (Eds.), Psychosomatic aspects of paediatrics (S. 9
- 15). Oxford : Pergamon Press.
Vaughan, G. F. & Cashmore, A. A. (1954). Encopresis in childhood. Guy´s Hospital Report, 103, 360 - 370.
Vogl, A. (1983). Enkopresis. Eine Beziehungsfrage in Ursache, Diagnose und Therapie. Österreichische Ärztezeitung, 1, 32 - 36.
Wagerer, M. (1978). Vier Fallskizzen über Jungen mit dem Symptom Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 27, 21 - 27.
Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (1990). Menschliche Kommunikation. Bern: Huber.
Weber, D. (1952). Scenotest bei psychotischen Kindern und Jugendlichen. Zentralblatt für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 119, 294.
Weber, D. (1966). Scenotest bei Kindern und Jugendlichen mit Psychosen schizophrener Prägung. Diagnostica, 12, 67 - 76.
Weltgesundheitsorganisation (1991). Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10, Kapitel V (F). Göttingen: Huber.
Wille, A. (1984). Die Enkopresis im Kindes- und Jugendalter. Berlin: Springer.
Willital, G. H., Groitl, H., Zeisser, E., Riedl, A. (1977). Fortschritte in der Diagnostik funktioneller Störungen des Enddarms bei Kindern - chirurgische Konsequenzen. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 125, 2 - 7.
Wolff, G. (1969). Ein Beitrag zur Analyse der Persönlichkeit des Enkopretikers. Eine Untersuchung an Hand der vorliegenden Literatur, einer eigenen Patientenstichprobe sowie psychodiagnostischer Testergebnisse. Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg.
Wolters, W. H. G. (1971). Encopresis. Psychotherapy and Psychosomatics, 19, 266 - 287.
Wolters, W.
H. G. (1974). A comparative study of behavioural aspects in encopretic
children. Psychotherapy and Psychosomatics, 24, 86 - 97.
Wolters, W. H. G. (1978). The influence of environmental factors on encopretic children. Acta Paedopsychiatrica,
42, 159 - 172.
Wolters, W.
H. G. & Wauters, E. A. K. (1975). A study of somatopsychic vulnerability in
encopretic children. Psychotherapy and Psychosomatics, 26, 27 - 34.
Woodmansey,
A. C. (1967). Emotion and the motions: An inquiry into the causes and prevention
of functional disorders of defecation. The British Journal of Medical Psychology,
40, 207 - 223.
Wright, D.
F. & Bunch, G. (1977). Parental intervention in the treatment of chronic
constipation. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 8, 93 -
95.
Wunderlich, C. (1958). Das Umweltproblem im Scenotest. Das medizinische Bild, 1, 79 - 85.
Wurst, F. (1982). Enkopresis. In: H. Asperger & F. Wurst (Hrsg.), Psychotherapie und Heilpädagogik bei Kindern (S. 195 - 201). München: Urban & Schwarzenberg.
Young, G.
C. (1973). The treatment of childhood encopresis by conditioned gastro-ileal reflex
training. Behaviour Research and Therapy, 11, 499 - 503.
Zierl, W. (1959). Therapeutisches Rollenspiel im Sceno-Test ("Scenodrama"). Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 8, 113 - 124.
Zimmermann, F. & Degen, W. (1978). Erfahrungen mit dem gemeinsamen Sceno. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 27, 245 - 253. Zimmermann, F. (1976). Zur Theorie der Scenotestinterpretation. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 25, 176 - 182.
Anlage A
Beobachtungsbogen für den Sceno-Test
Name: Datum :
Ort der Untersuchung:
Alter: Name des Untersuchers:
A. Feststellung der Wesensart und der Charaktereigenschaften der Vp.:
I. Durch Beobachtung des Verhaltens zur Umgebung
1. Zu dem Untersucher
2. In der neuen Situation
II. Durch Beobachtung des Verhaltens im Spiel:
1. Handhabung des Sceno-Testmaterials
(Initiative - Selbstsicherheit - Gehemmtheit, u.a.)
2. Gestaltung des Spieles
(Produktivität und Gestaltungsfreude - Einfälle und Phantasie -
Selbständigkeit - Temperament - Gefühlsbetontheit - Farbensinn -
Wirklichkeitssinn u. a. )
3. Intelligenz im Spiel
(Der Altersstufe entsprechend - dem Spielmaterial angepaßt -
Herausfinden der technischen Besonderheiten des Spielmaterials - Zur
Ausdrucksgestaltung, zum Gebärdenspiel und zum scenischen Aufbau
u.a.)
4. Aufmerksamkeit
(Tenacität und Vigilität - Intensität - Ausdauer u.a.)
5. Persönliches Tempo und Eigentümlichkeit der allgemeinen Motorik
6. Manuelle Geschicklichkeit
B. Feststellung der speziellen Problematik der Vp. durch:
1. Beobachtung der bewußten Beziehungnahmen der Vp. zu den einzelnen
Puppenfiguren:
a) Auswahl der im Spiel auftretenden Puppen und ihre Rollenzuteilung
b) Behandlung der einzelnen Puppenfiguren im Verlauf der Darstellung
2. Beobachtung der unbewußten Beziehungnahmen der Vp. zu den
Puppenfiguren:
a) im Aufbau der Gesamtscene :
in den Gesten
in ihrem Agieren
in ihrer inneren Beziehungssetzung zueinander
b) in den Spontanäußerungen zu der Scene
c) in den auf Aufforderung gebrachten Einfällen der Scene
C. Kurze Zeichnung der Scene
Anlage B
Nachfolgend sind die
Testauswertungsprotokolle der für diese Untersuchung zur Verfügung stehenden
Scenotestschlußbilder von 28 Enkopretikern beigefügt.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 1 Alter
: 7 ½ Geschlecht : Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 37
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel- / Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Fuchs
"aggressiv" gegen Henne
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Die Szene links oben zeigt eine Schule. Die Kuh ist auf dem Bauernhof. Die Bauklötze stellen den Bauernhof dar. Die Mutter ist eine Leiche. Das Auto springt über eine Schanze, der Affe klettert auf dem Baum umher. Der Fuchs jagt die Henne. Der Engel ist die Kirche. Die Szene mit dem Liegestuhl symbolisiert ein Picknick im Garten.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 2 Alter:
10 Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 39
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Hund
als Kamerad einer Figur
·
Autoritäre
Vaterfigur
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Krokodil
eingesperrt
·
Ganter
eingesperrt
·
Aggressionen
gegen Mutterfigur
·
Passive
Mutterfigur
·
Schultafel
im Mittelpunkt der Szene
·
Diagonale
Spannung (Schneemann / Mutterfigur)
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Das Thema der gespielten Szene ist "Garten". Der Ganter, das Küken und das Krokodil sind im Wasser. Die Versuchsperson stellt sich als Vaterfigur dar. Der Vater zeigt der Mutter etwas an der Tafel und erklärt es ihr. Das Mädchen auf dem Stuhl "soll da nicht zur Oma, die auf dem Klo-Stuhl sitzt, reinglotzen" - sodann wird eine Mauer davor gebaut. Die Autos stehen auf dem Parkplatz.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 3 Alter:
9 11/12
Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 31
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Schutzbauten
·
Mutter
bzw. Vater/Kind Situation
·
Vater/Baby
Situation
·
Hund
als Kamerad einer Figur
·
Kind
isoliert
·
Essensszene
·
Angriffe
gegen Kinderfiguren
·
Liegende
Menschen
·
Passive
Vaterfigur
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Das Thema der Szene lautet : die Mutter holt die Kinder zum Essen. Das Gebäude hinter der Frau in Arbeitskleidung ist ein Haus mit Schornstein. Der Junge liegt mit dem Bauch auf dem Zug und macht eine Todesfahrt. Dabei schreit er zur Großvater - und -mutterfigur: "Eihh, ihr alten Krüppel". Der Hund wartet auf das Fressen, das er von der Mutter bekommt. Der Vater kommt mit dem Baby gerade vom Einkauf, „das machen nicht nur die Mütter". Oma und Opa stehen da so rum. Die Kinder spielen mit der Eisenbahn. Der Schneider (Mann im Straßenanzug) und der Bäcker (Arztfigur) streiten sich um den Preis des Brotes. Der Schneider ist mit dem Preis nicht einverstanden. Die Frauen unterhalten sich. Der Liegestuhl steht im Garten. Die Versuchsperson stellt sich in Form des kleinen Jungen dar. Er bringt die Kuh in den Stall - „ich packe sie an den Hörnern und bringe sie rein".
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 4 Alter:
10 ½ Geschlecht:Weiblich
1. Scenotestbild aus Sicht des
Kindes
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 58
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel- / Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Mutter/Kind
Situation
·
Großvaterfigur
streichelt die Kuh
·
Hund
als Kamerad einer Figur
·
Haustiere
im Zentrum der Szene
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Fuchs
aggressiv gegen den Ganter
·
Ganter
als Opfer
·
Passive
Mutterfigur
·
Schultafel
im Mittelpunkt der Szene
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Anfänglich zögerlicher Aufbau, dann zügiger. Statisch, kein Rollenspiel bis auf die Fuchs - Gans Episode. Der Fuchs beschaut den Ganter, dieser wird von der Mutter auf den Arm genommen, der Hund tritt dem Fuchs ebenfalls entgegen. Bei den Küken wird ein Hühnerhof abgeteilt. Das Krokodil wird als nicht passend aus der Umgrenzung herausgenommen und durch das große und kleine Schwein ersetzt. Der Großvater streichelt eine Kuh.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 5 Alter:
9 ½ Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 48
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Erster Griff nach dem Klo-Stuhl. Dann stellt er es wieder weg. Langsamer aber gezielter Aufbau. Sehr symmetrisch und farblich geordnet. Stabil um eine Ecke.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 6 Alter:
4 2/12 Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 50
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Krokodil
aggressiv gegen Klo-Stuhl gerichtet
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Das ist ein ganz schönes Schloß. Da wohne ich ganz alleine drin. Ich bin bei der Kuh. Die Versuchsperson hat große Mühe in der Szene noch mehr zu sehen. Die Eisenbahn, der Klo-Stuhl und das Auto werden von ihr erwähnt. Das Krokodil hat die Versuchsperson nicht gesehen. Das Auto ist meines.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 7 Alter:
7 ½ Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 37
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Krokodil
aggressiv gegen die Kuh
·
Passive
Vaterfigur
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Als erste Figur wird das Krokodil plaziert. Danach fummelt er lange am Liegestuhl herum. Der Bauer wird in den Liegestuhl gelegt. Die Kuh wendet sich ab, das Krokodil greift die Kuh an. Das Ganze spielt auf einer schönen Wiese mit Wald. Die Versuchsperson selbst tritt in der Szene nicht auf.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 8 Alter:
8 3/12
Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
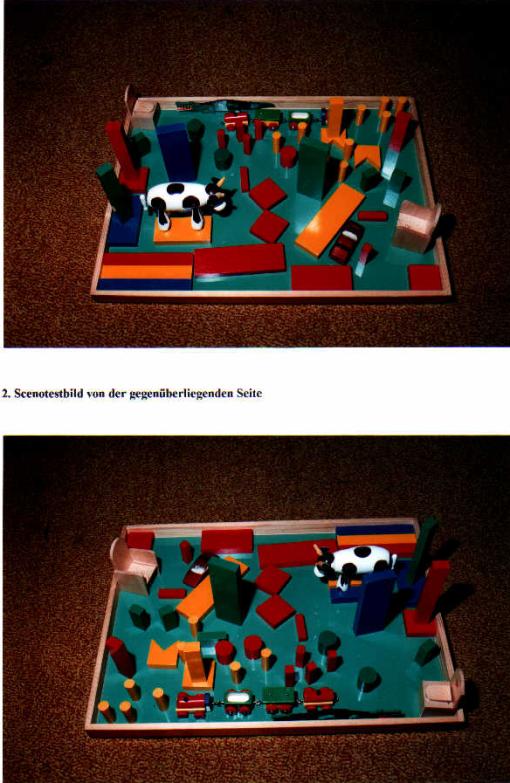
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative
Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände
insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 67
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Haustiere
im Zentrum der Szene
·
Fuchs
eingesperrt
·
Krokodil
eingesperrt
·
Ganter
alleine
·
Schutzbauten
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Zunächst baut er eine sehr enge, überdachte Behausung für die Kuh, schließlich teilt er die Szene in verschiedene Segmente ein, es gibt Zäune oder Mauern, auch weitere enge Ställe für die Schweine.
Wem es am besten gehe ? Dem Vogel.
Wer er am liebsten wäre ? Das Krokodil.
Ein Gespräch mit ihm ist auch weiter nicht möglich. Als ich bemerke, das es die Kuh ja vielleicht etwas eng hat, geht eine kleine Bewegung und Verunsicherung durch seinen Körper und ich habe die Phantasie, daß er jetzt möglicherweise den Stall ganz schnell erweitert. Er tut es dann aber doch nicht, blickt mich nur unsicher an. Woraufhin ich dann sozusagen meine Bemerkung dann wieder zurückziehe und einräume, daß der Stall vielleicht eng sei, daß die Kuh ja aber dennoch eine Menge Auslauf habe.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 9 Alter:
7 10/12 Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
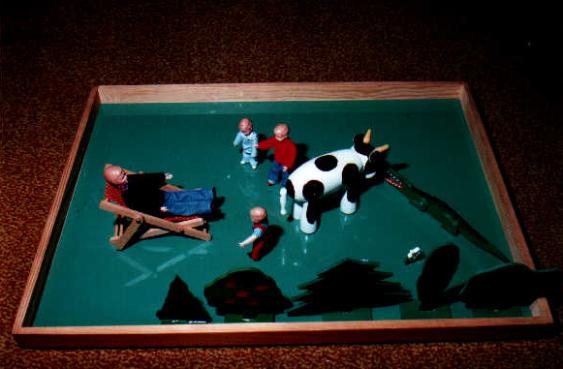
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 21
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Elemente
der Warnung und Kontrolle
·
Festungsbauten
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Er baut nun eine Hochgarage, ergänzt sie durch zwei Antennen. Zwei Leute werden aufpassen, daß keiner Sprühdosen oder eine MG dabei habe. Die werden dann der Polizei Bescheid sagen, ob es okay ist, dann können die Autos durchfahren. Ich hebe die Gefährlichkeit des Gewehres hervor, er bestätigt das, aber eher in neutralem Tonfall. Das technische Verharren bei der Sceno-Gestaltung erinnert mich eher an ein älteres Kind.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 10 Alter: 10 Geschlecht:
Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
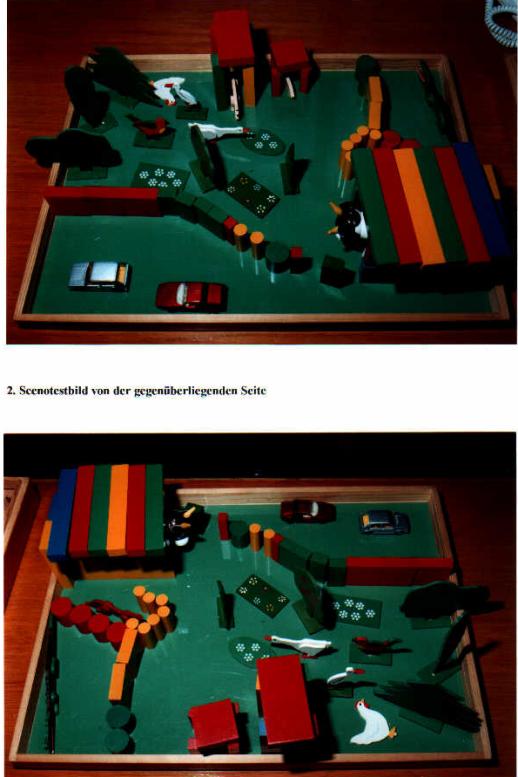
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 36
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Beziehungslosigkeit
der Puppen
·
Vaterfigur
streichelt die Kuh
·
Elemente
der Warnung und Kontrolle (Zwerg, Engel)
·
Krokodil
aggressiv gegen Ganter
·
Ganter
aggressiv gegen den Vogel
·
Fuchs
aggressiv gegen den Affen
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Hier fällt eine Teilung zwischen vorderem und hinterem Teil deutlich ins Auge. Im vorderen Teil werden eine Menge Personen aufgestellt, die kaum Beziehung zueinander zu haben scheinen, jedenfalls stehen sie nur mit dem Gesicht zur Versuchsperson, aber ohne Beziehung zueinander aufgenommen zu haben. Auch das Baby liegt irgendwie achtlos dazwischen. Hier auch auffällig, daß die Kuh zwischen dieser Menschenmenge steht und zwar hinter einer Mutterfigur. Abgegrenzt hiervon durch einige Bäume stehen in der Mitte das Krokodil, links davon die Gans und der Schneemann, rechts davon der Engel, der Zwerg und der Fuchs. Beim Engel findet sich auch ein Grab. Die Tiere haben mehr Beziehungen zueinander, allerdings aggressive. Das Krokodil ist hinter der Gans her, will sie fressen. Die Gans ist stur. Der Affe tritt dem Fuchs ins Gesicht, der ist auf Beutefang. Das Küken schreit, die Henne hält Wache. Unter den Blumen ist jemand begraben. Der Engel paßt auf, daß der Fuchs oder das Krokodil niemanden frißt. Der Zwerg stellt übrigens den Weihnachtsmann dar, der ist wie der Engel so eine Art Wache, damit es nicht zum Unglück kommt.
Am besten hat es das Baby. Es braucht nicht zur Schule, kann zu Hause bleiben. Als er Baby war, war die Schwester noch nicht da und er war mit Mama und Papa alleine.
Zur Kuh kommentiert er: Die kann sich gut bewegen und sie möchte gestreichelt werden.
Am schlechtesten geht es den Erwachsenen, insbesondere dem Vater.
Er identifiziert sich mit dem Fuchs.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 11 Alter:
9 Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
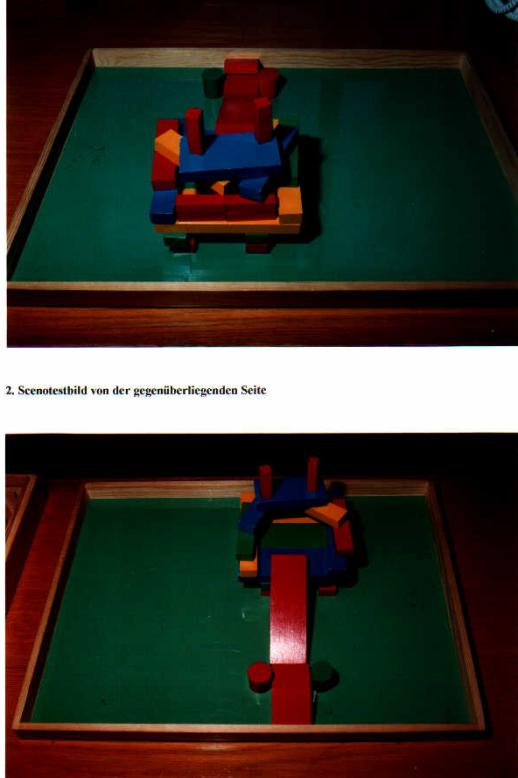
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 9
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Aggressionen
gegen Vaterfigur
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Krokodil
aggressiv gegen eine Vaterfigur
·
Passive
Vaterfigur
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Nicht vorhanden.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 12 Alter: 14 Geschlecht:
Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
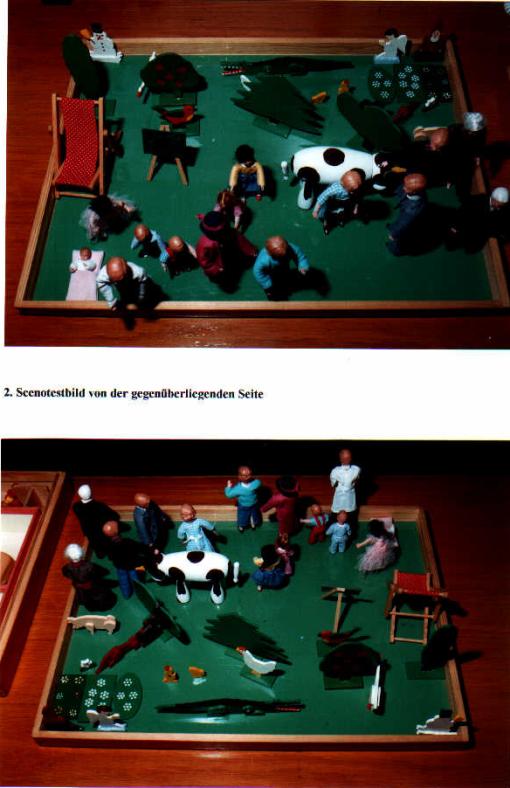
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 53
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2.
Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Unfallszene
·
Ganter
alleine
·
Fuchs
wird überfahren
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Nicht vorhanden.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 13 Alter:
7 Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
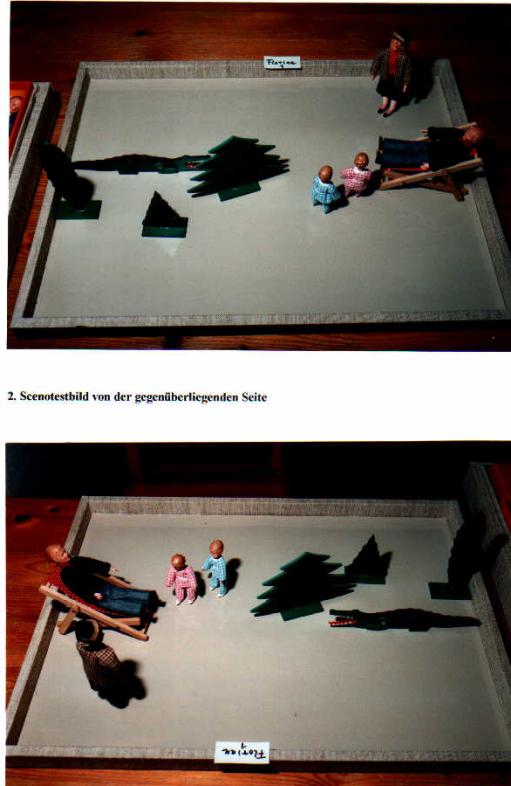
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative
Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 53
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Baby
abseits gelegt
·
Ganter
alleine
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Nicht vorhanden.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 14 Alter: 8 7/12
Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
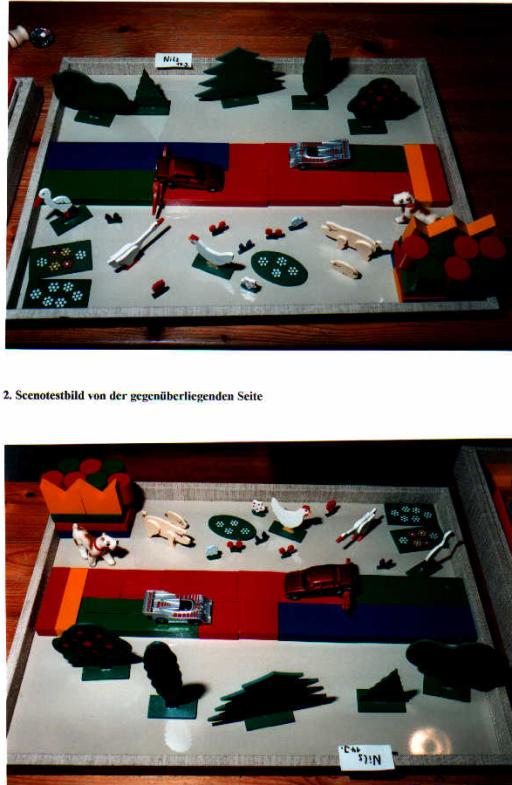
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 33
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Essenszene
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Thema "Hänsel und Gretel".
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 15 Alter: 12 Geschlecht:
Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
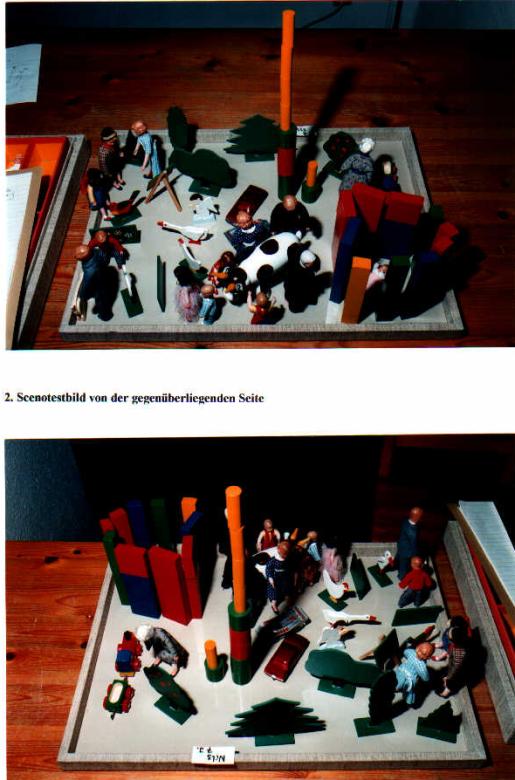
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 45
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2.
Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Beziehungslosigkeit
der Puppen
·
Liegende
Menschen
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Krokodil
aggressiv gegen Fuchs
·
Passive
Mutterfiguren
·
Schutzbauten
·
Passive
Vaterfigur
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Ganz viele Klötze sortiert er. Baut behutsam. Hoher umbauter Raum, fällt in sich zusammen, aufstöhnen. „Das wäre natürlich viel höher - das Empire State Building - flieg ich hin - nach einem Bild gebaut". Jetzt Großvaterfigur - Austausch mit Großmutterfigur - „das ist die Freiheitsstatue von New York". Bäume - das ist der Central Park. Immer wieder tiefes erschrockenes Einatmen, wenn er mit seiner Bewegung zu dicht an das Empire State Building kommt. Ganz oben ein Vogel drauf. Greift der Kuh zwischen die Beine. Klo, Krokodil und Fuchs. Eisenbahn: „Hier ist jetzt irgendwo ein Bahnhof - wo weiß ich auch nicht". Außerhalb: Frau mit Schultafel und Kindern. Spitze des Empire State Buildings - Litfaßsäule; „damit die auch im Flugzeug was lesen können". Außerhalb gebaut - noch mehr Wolkenkratzer und „das sind alles Mülltonnen - Straßen gibt es ja auch hier irgendwo" - Berühmte Kirche. Alles spielt in New York. Schneemann aus Plastik in Erinnerung an Winter; Klo-Stuhl - ein altes - zum anschauen - das kann man nicht mehr benutzen; Krokodil - Das Krokodil ist in den Everglades ganz schön weit entfernt.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 16 Alter: 10 ¼ Geschlecht:
Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
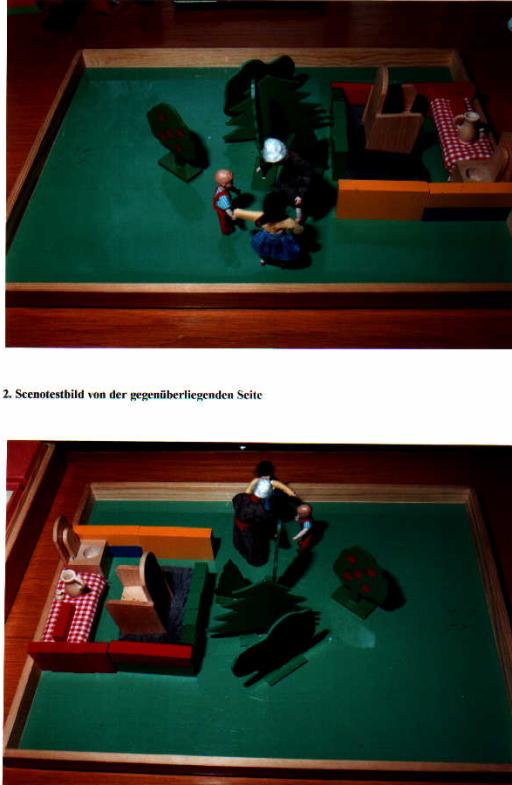
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 46
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Schutzbauten
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Thema: Rennbahn, Training, kein Wettbewerb.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 17 Alter: 5 10/12 Geschlecht:Weiblich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
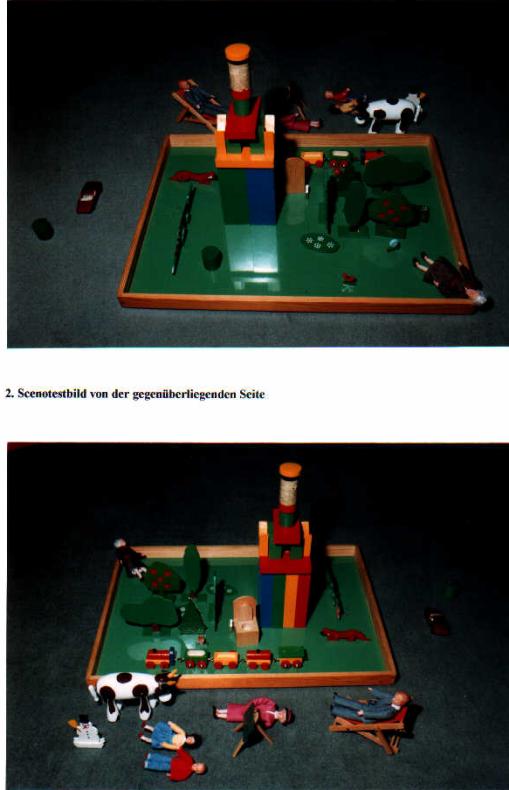
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 45
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Sie baut zunächst stumm und auch ohne mimische Bewegung aus Klötzen eine Art Trog, den sie mit Klötzen abdeckt. Darauf stellt sie dann Walzen und schmale Klötze. Als ich mitreagiere, d.h. meiner Anspannung Ausdruck verleihe, als die Klötze anfangen zu wackeln, reagiert sie erstmals mimisch. Ihr Gesicht zeigt beispielsweise ein leichtes, triumphierendes Lächeln, als es ihr gelingt, weitere Klötze aufeinanderzustellen, ohne daß das Gebäude zusammenstürzt. Als dann doch ein Gebäude zusammenstürzt, entwischt ihr ein leises "Mischt". Sie fängt mit weiteren Gebäuden an. Als dabei schon Gebautes wiederum einstürzt, meint sie : „Gott schei Dank, ischt nischt alles kaputtdegangen". Danach, es sind mittlerweile etwa 20 Minuten vergangen, ist eine erste Kommunikation zwischen uns möglich, d.h. sie beantwortet meine an sie gerichtete Frage, was sie baue, knapp mit „ein Hochhausch". Gerade als ich im Begriff bin, sie zu fragen, ob sie zu dem im Sceno Gebauten noch etwas hinzumachen wolle, nimmt sie den dunkelhaarigen Jungen und das Mädchen im Spitzenkleid heraus. Meine Bemerkung „es kommen jetzt noch welche dazu", ist aber offenbar zu viel oder zu früh. Sie nimmt nämlich die beiden Puppen wieder weg und erklärt: „Jetzt will ich aber zu Mama". Mein „du kannst aber noch etwas weiterbauen" kommentiert sie mit einem klaren und knappen „will ich aber nicht".
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 18 Alter: 7 1/12 Geschlecht:Weiblich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
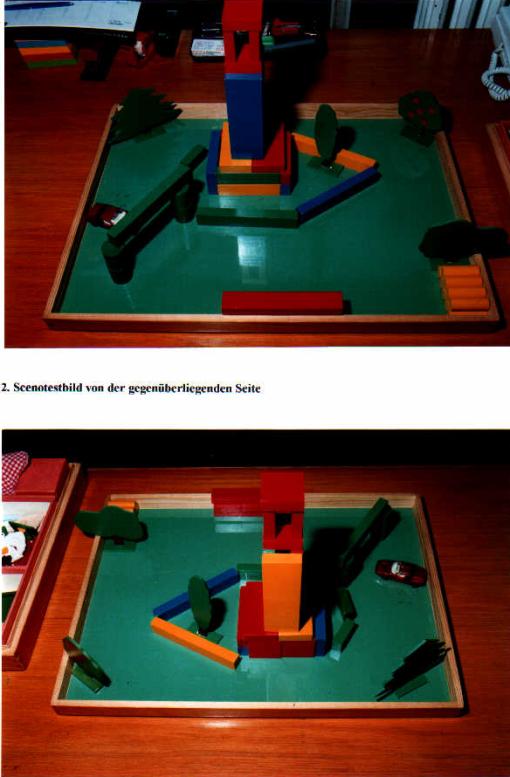
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente
= minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 7
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Als ich den Deckel öffne, sagt sie erschrocken: „Uh, ein Krokodil" und weicht zurück. Dann guckt sie sich das Baby mit der Flasche an. Sie beschließt einen Bauernhof zu bauen. Sie nimmt die Kuh, einen "Bauern" und sucht eine Bäuerin - "Großmutterfigur". Als ihr beim bauen das Baby am Ärmel hängen bleibt, schimpft sie „Du sollst nicht an mir hängen". Sie will dann links in die Ecke ein Haus bauen, was sie mit den Bauklötzen versucht bzw. andeutet. Die Tafel stellt sie in die Überdachung, damit diese nicht "vollpläddert". Sie sucht dann ein Kind, findet zunächst eine Frau und stellt fest, daß ein großes Kind nicht dahin passe. Das kleine Mädchen melkt nun die Kuh "strip, strap strull, der Eimer der muß voll". „Dann entdeckt sie das Klo. Komisches Klo, na ja - ein Klo ist aber wichtig". Sie will die Toilette in die Überdachung stellen, die aber zu klein ist. Dann soll jemand zum Klo gehen. Zuerst nimmt sie den Mann, beschließt dann aber doch die Frau zu nehmen. Bei dem Versuch die Frau auf die Toilette zu setzen, kracht ihre Überdachung zusammen und sie packt sie weg. Der Bauer und die Bäuerin unterhalten sich dann, während das Kind den schweren Eimer schleppt. Dann muß auch das Kind zur Toilette, danach hört es Mama und Papa zu. Nachdem sie mir das alles erzählt hat, geht sie weg. Ich bitte sie mir noch etwas über den Bauernhof zu erzählen. Sie antwortet nur knapp, daß es allen gut gehe, sie selber komme in der Geschichte nicht vor.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 19 Alter:
5 4/12 Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 28
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Passive
Vaterfigur
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Er nimmt zunächst den Liegestuhl, hantiert damit herum und findet durch Versuch und Irrtum die richtige Funktionsweise. Als er erzählt: „das hab´ ich schon ´mal gebaut", denke ich zunächst an ein Sich-selbst-Bestätigen. Er wies jedoch darauf hin, daß er im Erstgespräch mit der Mutter mit dem Scenokasten gespielt hat. Er nimmt die verschiedenfarbigen Bauklötze und umrahmt das Sceno-Brett. Als ich ihn frage, was er gebaut hat, entgegnet er mir: „Mußt Du doch wissen, was ich gebaut hab´". Es soll einen Zaun darstellen. Er nimmt den Armstuhl und das Klo und stellt es dem Liegestuhl gegenüber. Er fragt sich: „Wer hat das wohl gebastelt ?". Sein Großvater bastelt viel Spielzeug für die Kinder. Er nimmt sämtliche Bäume und stellt sie wie eine Allee auf. Über die Assoziationsreihe "Bäume-Garten-Wald" entscheidet er sich, daß es ein Wald sein soll. An mich wendet er sich mit der Frage: „Sieht doch so aus, oder ?". Der Wald ist begrenzt durch den Liegestuhl, durch die gegenüberliegenden Bäume fährt der Zug, wobei er die Lok komisch findet. Die Exploration ist äußerst spärlich: Auf meine Frage, ob er jemand sein möchte, antwortet er mit einem klaren Nein, und wie es dem Mann auf dem Liegestuhl geht beantwortet er mit Gut. Sein Sceno soll darstellen: Durch den Garten fährt eine Lok. Und er ergänzt, daß der Zug nicht weiterfahren kann, weil der Liegestuhl im Weg ist.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 20 Alter:
6 2/12 Geschlecht:Weiblich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
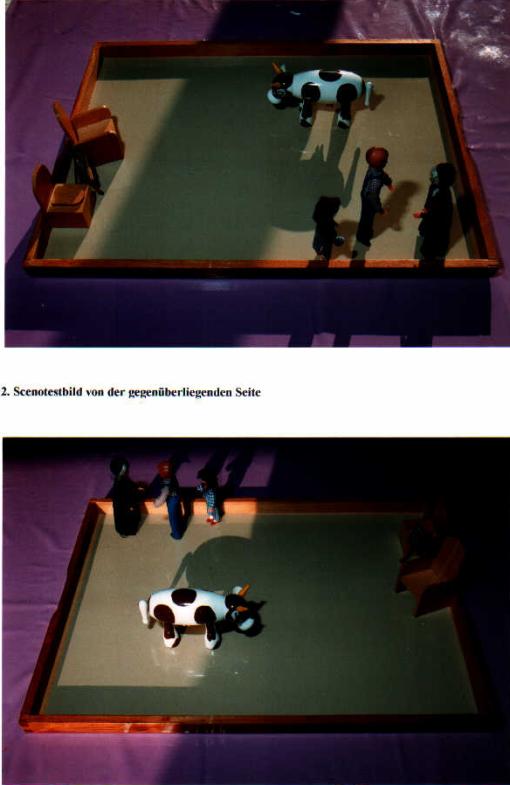
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative
Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 31
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Mutter-Kind
Situation
·
Hund
als Kamerad des Kindes
·
Liegende
Menschen
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Krokodil
aggressiv gegen den Fuchs
·
Ganter
alleine
·
Passive
Mutterfigur
·
Baby
auf Fell
·
Kind
abseits gestellt
·
Aggressionen
gegen Vaterfigur - indirekt -
·
Passive
Vaterfigur
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Sie stellt beginnend mit den Erwachsenen immer Paare zusammen, wobei die Altersgruppenzuordnung der Paare nicht paßt, d.h. z.B. Großmutter und Mann im weißen Kittel bilden ein Paar, sowie Großvater und Frau im geblümten Kleid. Als die Oma immer wieder umfällt, kommentiert sie etwas kasprig-wütend: „Das ist ´ne verdammte Frau, wenn die nicht stehen bleibt !" Mit dem Ausruf „Ach, lauter süße kleine Kinder" stellt sie nun ebenfalls wieder Mädchen und Jungen paarweise zuordnend, Kinderpaare zu Erwachsenenpaaren. „Mädchen zu Mädchen, das geht ja nicht". Als ich frage warum, erhalte ich darauf keine Antwort. Als ich sie frage ob sie es besser fände, wenn sie noch einen Bruder in ihrem Alter hätte, nickt sie aber sehr spontan. Etwas ratlos stellt sie fest, daß das Mädchen mit dem schönen Kleid aber jetzt keinen Mann mehr hat. Sie löst das Problem zunächst so, daß sie das Mädchen auf den Liegestuhl legt. Im Spiel breitet sie sich nun über die Spielfläche hinaus aus, in dem sie links auf der Liege ein Wäldchen ein Wäldchen baut, in dem der Fuchs schleicht. Den Affen, den sie eigentlich auch ganz gerne verwenden möchte, legt sie mit der Bemerkung : „Der gehört eigentlich nicht dazu" wieder in den Kasten zurück. Erklärend meint sie dazu, daß es hier ja keine Affen gäbe. Dieses Problem hat sie dann aber nicht mit dem Krokodil. Das Baby wickelt sie in die kuschelige Decke ein (Fell), mit der sie sich vorher mehrfach an der Wange gestreichelt hatte. Dann fängt sie an mit dem Gebauten zu spielen. „Das Baby krabbelt wohl da jetzt zu dem Wald hin. Das merken die nicht, und daß der Fuchs da ist. Der beißt es. Das ist im tiefen, tiefen Wald, wo keiner es findet !" Das Mädchen im Spitzenkleid stellt fest, daß das Baby verschwunden ist. Die Eltern reagieren doch besorgt. Das Mädchen im Spitzenkleid bietet an, das Baby zu suchen, kehrt aber nach einer Weile zurück und berichtet der Mutter (Frau im geblümten Kostüm): "Ich hab´das Baby nicht gefunden nur die Flasche". Die Mutter: "Such weiter". Das Mädchen im Spitzenkleid findet nun das Baby und trägt es zur Mutter zurück. "Mama, Mama hilfe, ein Fuchs" Die Mutter: "Verschwinde mit dem Kind, ich laß das Krokodil frei. Lauf Krokodil" Das Krokodil frißt nun den Fuchs. Meine Bemerkung, die hätten offenbar auf das Baby nicht aufgepaßt, bestätigt sie und fügt hinzu : „Die Mutter hat auch gar nicht daran gedacht. Sie legt die Mutter nun auf den Liegestuhl. „Die ist so kaputt". Das Mädchen im Spitzenkleid muß nun auf´s Klo. Es hat aber Angst, weil es am Krokodil vorbei muß. Der Vater : "Nun geh schon auf´s Klo. Ich muß da auch noch drauf". Nachdem das Mädchen auf dem Klo war, setzt sich dann der Vater auf den Pott. Auf Nachfrage meint sie, daß das Mädchen im Spitzenkleid es am besten habe, weil das ja so schön angezogen sei. Der Junge im Schlafanzug habe es wohl am schlechtesten, weil der nichts zum Reiten habe. Sie nimmt damit Bezug auf das Mädchen im Schlafanzug, das auf dem Hund (von ihr als Ziege bezeichnet) reitet. Wer sie selbst am liebsten wäre, sagt sie dann aber nicht.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 21 Alter: 7 Geschlecht:
Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 25
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Schutzbauten
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Er weiß nicht so recht was er bauen soll. Es entsteht ein Haus, das er auch recht sorgfältig mit Klötzen abdeckt. Dahinter stellt er einige Bäume auf und ein Auto. Er erklärt, das Ganze soll ein Haus mit einer Garage sein. Das Auto dahinter fahre auf der Straße. Er erläutert, daß er die Form des Hauses nach dem Kindergarten gewählt habe, den er besuche. Er korrigiert dann, daß er dort jetzt in den Hort geht.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 22 Alter: 6 Geschlecht:Weiblich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
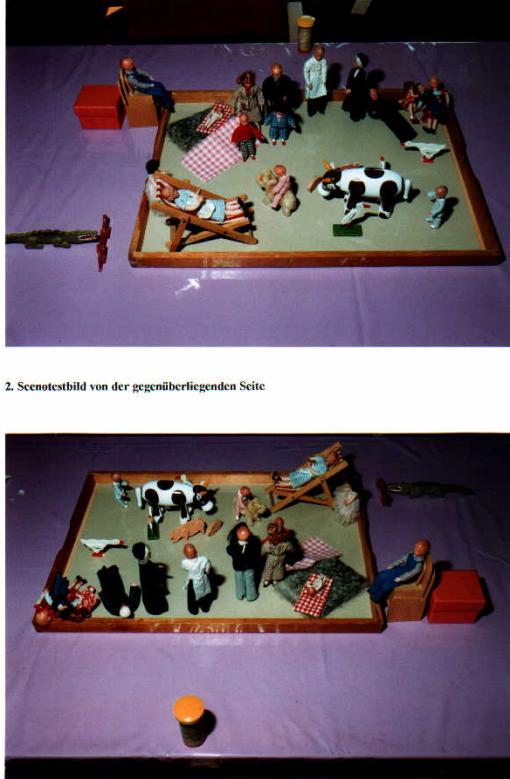
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 40
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Beziehungslosigkeit
der Puppen
·
Krokodil
eingesperrt
·
Ganter
aggressiv gegen Großmutterfigur
·
Aggression
gegen Mutterfigur (direkt)
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Sie lehnt die Kuh mit dem Hinweis „zu wackelig" ab, um danach bei allen weiteren Figuren davon fasziniert davon zu sein, daß die mit Hilfe der Magnetfüße Standvermögen haben. Sie plaziert Bäume, dann Menschen, die allesamt den neuen Garten bewundern. Sie nimmt das Krokodil in die Hand und schmeißt es mit einem lauten Ausruf „das ist böse" weg. Als ich frage, ob gar kein Platz da sei für das Krokodil, überlegt sie angestrengt und entscheidet es bekomme einen Platz in einem Käfig. Aber mit Eisenstangen. Sie baut einen sehr dichten Käfig um das Krokodil herum, was ihr Durchhaltevermögen auf´s äußerste strapaziert, da natürlich dauernd Menschen oder Steine umfallen. Aber letzendlich gelingt es - und der Effekt ist der, daß eine ganze Familie dieses Krokodil bestaunt.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 23 Alter:
5 7/12
Geschlecht:Weiblich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
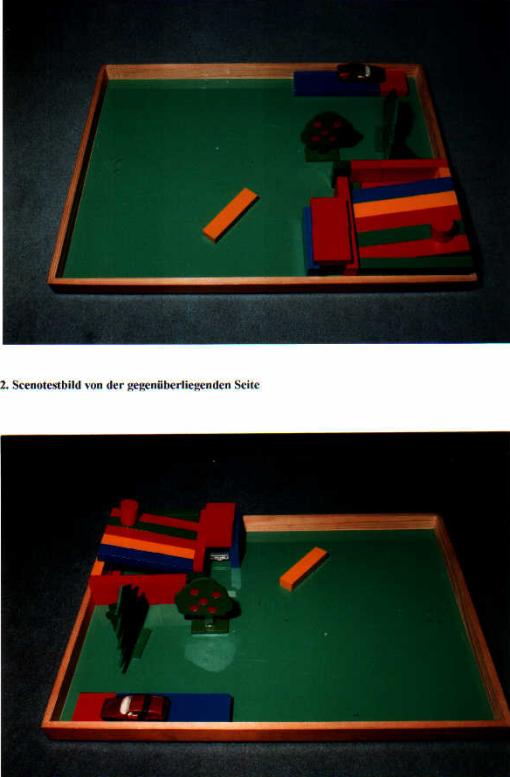
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 19
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Aggressionen
gegen Vaterfigur
·
Kranke
Menschen
·
Liegende
Menschen
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Fuchs
alleine
·
Mutter-Kind
(Baby) Situation
·
Hund
auf Fell
·
Passive
Vaterfigur
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Das Aufbauen, Spielen und Erzählen dazu ist insgesamt zäh und langatmig. Eine für mich fast zu lange Weile ist sie damit beschäftigt die Falte aus der etwas steifen Tischdecke herauszubekommen und diese vor allem geschmeidiger zu machen, was natürlich nicht gelingen kann. Weiter fällt mir auf, daß sie allen Puppenfiguren die sie in die Hand nimmt unter den Rock guckt. Dies habe ich so noch nie erlebt - dabei sehe ich aber zum erstenmal, daß die Oma einen Spitzenunterrock trägt. Die Omafigur soll eine Lehrerin sein, sie könne nach ihrer Ansicht auch eine Mutter sein. Die Mutter wird dann aber doch eine andere, sie stellt noch ein Mädchen, die Prinzessin, das Baby und einen Hund auf. Dann fordert sie mich auf, den Papa auszusuchen. Dies lehne ich ab mit der Begründung, daß ich sicher bin, sie könne das alleine schaffen. Es fällt ihr sichtlich schwer, aber sie entscheidet sich letzlich für die Arztfigur. Sie entdeckt im Kasten den Teppichklopfer, legt ihn in das Kästchen, der als Tisch dient (Tischdecke darauf) und sagt: „Wenn einer böse ist". Sie baut ein Zuhause, eine Schule und einen Strand.
Sie erzählt und spielt folgende Geschichte: Das Baby krabbelt auf den Tisch, sitzt dort und fällt herunter. Die Mutter geht hin, hebt es auf und tröstet es. Sie hält es fest und geht zu Papa. Dann legt sie das Baby ins Bett. Die Mutter geht zu dem Vater und die beiden reden etwas. Da bald Winter wird, muß das Baby dick angezogen werden. Dann läßt die Mutter das Baby laufen, geht zu dem Vater und die Eltern drücken sich und schmusen. Das Baby fällt hin, die Mutter und der Hund kümmern sich darum. Die Eltern schmusen weiter und der Vater sagt, er ginge jetzt ins Bett. Die Mutter will mit dem Baby einen Schneemann bauen. Während dieser ganzen Zeit gehen die beiden Mädchen in die Schule. Sie müßen die Tiere lernen. Die Lehrerin zeige immer auf ein Bild, und die Mädchen müßen sagen, welches Tier das ist. Aber für eine richtige Antwort müßen sie sich erst melden. Wer dazwischenschreit bekommt keinen Punkt. Am besten ginge es dem Baby, das sei das glücklichste. Am schlechtesten ginge es dem Papa, der habe sich alles gebrochen, einen Arm und ein Bein. Sie legt daraufhin den Vater auf den Tisch, der nun eine Krankenbahre ist. Am nettesten ist die Lehrerin und am wenigsten nett sei der Fuchs, weil er so rot sei. Sie möchte am liebsten die Lehrerin sein, weil sie die Kinder gut behandelt.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 24 Alter:
6 10/12
Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
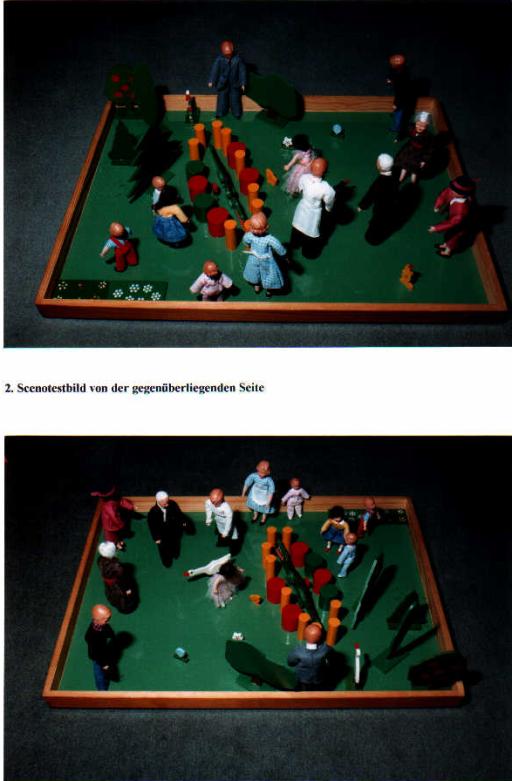
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6.
Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 20
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Fuchs
aggressiv gegen Krokodil
·
Krokodil
aggressiv gegen Henne
·
Ganter
aggressiv gegen den Schneemann
·
Passive
Mutterfiguren
·
Passive
Vaterfigur
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Er nimmt nur das Auto und die Litfaßsäule in die Hand, legt letztere wieder weg. Er ist unschlüssig, nimmt dann aber den Liegestuhl mit der Bemerkung: „den kann ich aufbauen", was eine glatte Selbstüberschätzung ist. Er setzt die Arztfigur hinein, baut wahllos Bäume, Blumen, den Schwan, den Weihnachtsmann und den Schneemann auf. Die Eisenbahn, die immer in der Runde fährt, dann das Krokodil und den Fuchs. Zwei Frauen setzt er dann mit dem Rücken zum Arzt. Allen Dreien gehe es am besten, meint er, er will offensichtlich nichts damit zu tun haben. Ich frage nach dem Krokodil, er wird lebhafter und sagt, daß es alle angreift, weil es so großen Hunger hat. Er fügt an: „So große Wut". er rettet sich, indem er den Fuchs das Krokodil töten läßt. Das sei so gefährlich, weil man es ärgert und weil es großen Hunger hat. mich wundert es nicht, daß bei dieser tödlichen Gefahr er am liebsten der Fuchs ist.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 25 Alter:
7 ¾ Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
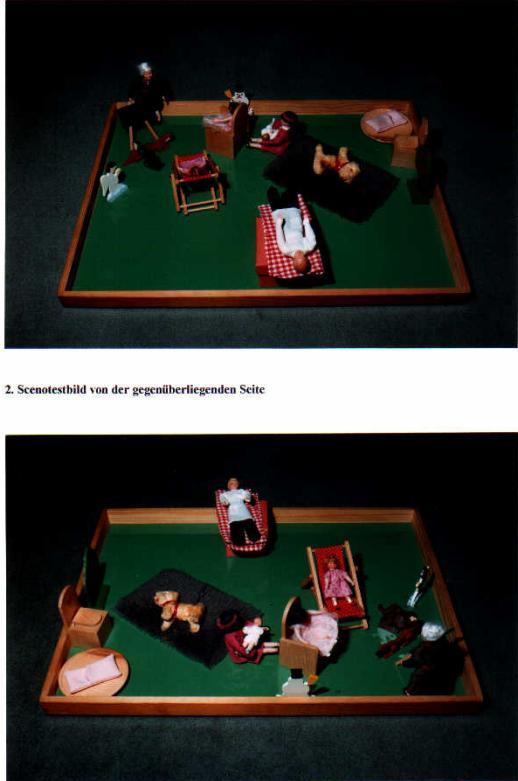
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 37
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Ganter
alleine
·
Fuchs
aggressiv gegen Ganter
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Thema: "Im Park". Er baut eine Schneise für die Autos und stellt Bäume und ein paar Tiere auf. Er selbst ist nicht dabei. Die menschlichen Figuren kann er nicht gebrauchen, die wären auch für die Autos viel zu groß. Der Affe auf dem Eingangsportal zum Park ist nicht echt.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 26 Alter: 7 4/12 Geschlecht:
Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
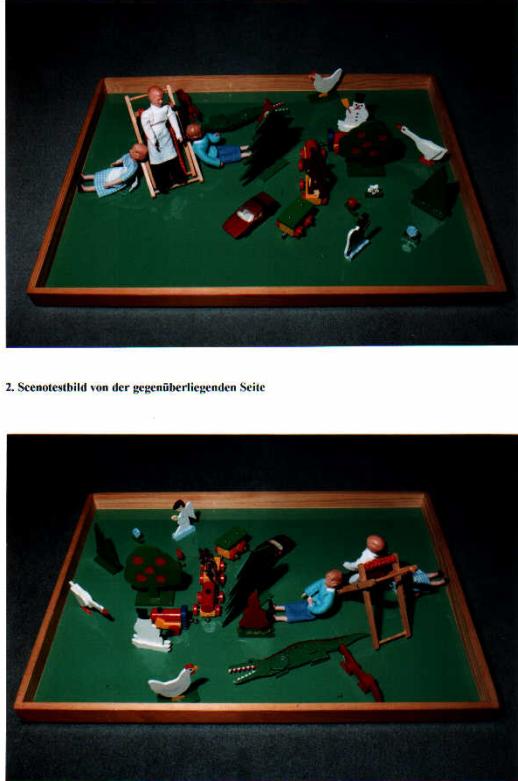
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 65
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Elemente
der Warnung und Kontrolle
·
Ganter
alleine
·
Fuchs
aggressiv gegen den Storch
·
Festungsbauten
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Es fällt ihm schwer, sich allein auf den Scenokasten zu konzentrieren, er möchte immer irgendetwas anderes mit dazunehmen, aus dem Puppenhaus oder von den Gegenständen die auf dem Fensterbrett stehen. Er sieht sich den Scenokasten eigentlich auch gar nicht genau an, wirkt eher uninteressiert. Die Bausteine allerdings sprechen ihn sofort an und er baut auch recht flott und gekonnt einen Turm den er zunächst aus Freude zum Einsturz bringt. Er wisse nicht, was das werden soll. Wahrscheinlich ein Turm, den er aber noch höher machen will. Alles andere entwertet er als Babyspielzeug. An dem Turm sind zwei Alarmsignale, die gehen los, wenn einer da unten am Eingang etwas anrührt. In diesen Turm darf nur der Präsident, der Kanzler Kohl. Der kann auch die Alarmsignale abschalten, der darf das. Nein, alleine würde der Präsident nicht in diesem Turm wohnen, sondern mit Frau und drei Kindern. Die Familie schlafe, dann esse sie Frühstück und dann gehen die Kinder zum Spielen. Die entsprechenden Figuren dazu will er aber nicht nehmen. Er stellt neben den Turm ein paar Tiere, überlegt ob Winter ist und entscheidet sich für den Schneemann. Ein Fuchs schleicht sich an den Vogel ran. Am Eingang wird noch ein Zaun gebaut, wenn an den die Tiere rankommen, geht der Alarm los. Nach der Familie gefragt erfahre ich, daß die Mutter krank ist, und es geht ihr am schlechtesten. Dem Präsidenten und den Kindern gehe es gut. Ein Kind habe ein bißchen Kopfschmerzen. Wer hilft dem Kind ? Der Präsident pflegt ihn, der hat nämlich frei, gibt ihm eine Kopfschmerztablette und sagt er solle schlafen.
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 27 Alter:
7 ¼ Geschlecht: Männlich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
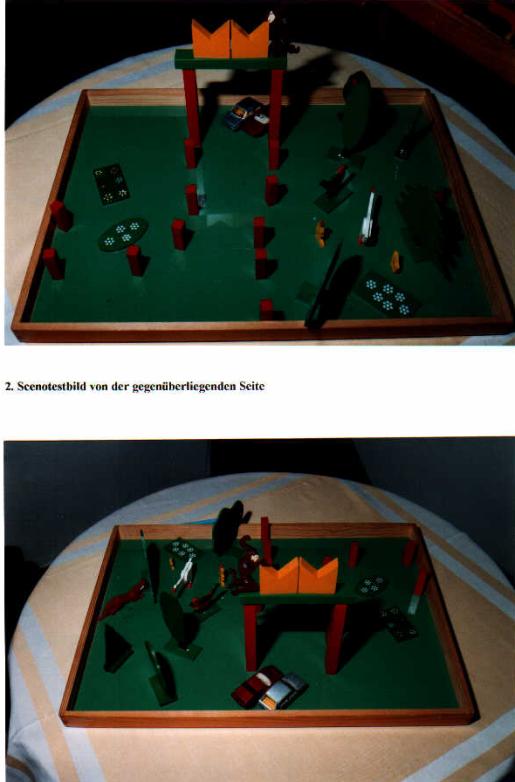
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative
Materialverwendung
Storch
Vogel 1. Anzahl Gegenstände
insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 44
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale
Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes
Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel- / Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses
Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen
einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung
der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Puppen
aggressiv
·
Teppichklopfer
aggressiv
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Krokodil
aggressiv gegen die Kuh
·
Ganter
aggressiv gegen die Kuh
·
Fuchs
aggressiv gegen die Kuh
·
Autoritäre,
strafende Mutterfiguren (2x)
·
Aggression
gegen Vaterfigur - indirekt -
·
Aggressionen
gegen Baby
·
Passive
Vaterfigur
E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Er greift den Mann im blauen Jackett heraus, verbiegt ihn etwas und sagt: „der ist tot". Etwas später meint er der schliefe. Dann sucht er ein Bett. Er stellt die Kuh auf, dann einen Hund, dessen Schnauze zunächst ganz nah am Maul der Kuh ist, dann stellt er den Hund so, daß er am Hinterteil der Kuh schnuppert. Sein Kommentar: „Der wartet auf die Schokolade". Hierzu lacht er. Nun brauche er ein Klo, nein, diese Figur setze er nicht darauf. Dann nimmt er das Krokodil, richtet es gegen den Bauch der Kuh. Der Mann mit dem weißen Kittel soll ein Geist sein, die Frau mit dem blauen Kleid und den weißen Punkten fliegt, bzw. will fliegen lernen. Er versucht nun, sie auf einem Bein fliegend hinzustellen, was ihm aber nicht gelingt. Dann entdeckt er den Affen. Das Kind davor haue ihm eins. Nein, mache es doch nicht. Hah, im Haus sei ein Baum. Das ist das Haus der Verrückten. Für den Mann, der schon auf der Toilette sitzt, stellt er eine Frau hinzu, lacht. Dann nimmt er den Teppichklopfer, dreht ihn um. Das soll ein Grab sein (also ein Kreuz). Ein Kind sitzt vor dem Fernseher, der aber in Wirklichkeit gar nicht da sei. Desöfteren betont er nun : „Hier ist das Haus der Verrückten". Verrückt sei auch, daß das Baby schon laufen könne. Auch die Kuh ist im Haus - das war ja auch verrückt. Ein kleines Kind will den Affen haben. Das Baby falle dauernd um (er hat es aus seinem Sack geholt). Nein, das Kind wird jetzt zerquetscht, nein, das Kind wird jetzt geköpft, weil es so klein ist, weil es ein Baby ist. Das Hemd wird hochgehoben und dann höhnisch "Pampers". Nun wird der Teppichklopfer umfunktioniert zu etwas womit man das Kind köpfen kann. Das tut die Frau im blau-weiß gepunkteten Kleid. Die Frau im blau-weiß gepunkteten Kleid kommt angeflogen, köpft das Kind nochmal. Er erklärt: wenn man groß und klein ist, wird man geköpft. Dann gäbe es aber nur einen Menschen und alle anderen wären geköpft. Er nimmt nun die beiden Küken, legt dazwischen das kleine Schwein und versucht alle drei so "aneinandergeklebt" hinzustellen, was ihm aber nicht gelingt. Die drei landen wieder im Kasten. er erklärt dann weiter, Oma (die Frau ganz links im Bild) will Mittag machen, aber der Herd ist nicht da und die andere Oma gucke dem Mann beim Pinkeln zu. Eine andere Oma sehe zum Krokodil und das Krokodil gucke, wie der Hund das Essen (Verdauungsprodukt) der Kuh haben wolle. Dem Mann im grauen Jackett gehe es am besten, der sei noch nicht verrückt. Er wolle nun raus, auch das Tor sei nicht mehr da. Ich frage was nun passiere ? Er: „Nun sei der Mann auch verrückt geworden".
Testauswertungsprotokoll für die Vp. 28 Alter:
6 1/12 Geschlecht: Weiblich
1. Scenotestbild aus Sicht
des Kindes
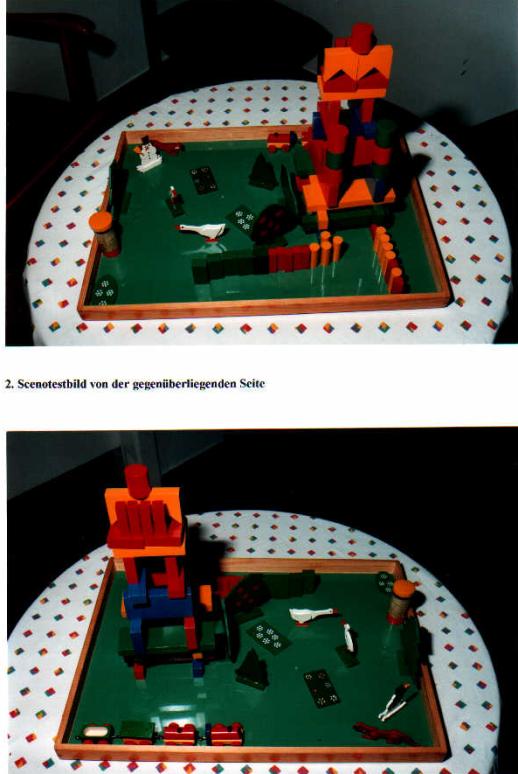
A. Liste der verwendeten Figuren:
1. Menschliche
Figuren 5.
Objekte
Großmutter Armstuhl
Großvater vier
Becher
Arzt Deckchen
Baby Eisenbahn
Frau in Arbeitskleidung Fell
Frau im Hauskleid Karfunkelstein
Frau im Straßenkleid Kanne
und Deckel
kleiner Junge Klo-Stuhl
kleines Mädchen Liegestuhl
Mann im Hausanzug Melkeimer
Mann im Straßenanzug Nuckelflasche
Prinzessin Nachttopf
Schuljunge Rennwagen
Schulmädchen Schultafel
Zwilling blau Schüssel
Zwilling rosa Stadtwagen
Tablett
2.
mythologische Figuren Teppichklopfer
Waschbottich
Engel Litfaßsäule
Schneemann
Zwerg 6. Bausteine
3. Tiere Achtelquader
eckige
kleine Säulen
Affe ganze
Quader
Fuchs halbe
Quader
Ganter Quader
mit Loch
großes Schwein lange
viertel Quader
Henne runde
große Säule
Hund runde
kleine Säule
zwei Küken Viertelquader
kleines Schwein
Krokodil
Kuh B.Quantitative Materialverwendung
Storch
Vogel 1.
Anzahl Gegenstände insgesamt
4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal
8
- 17 Elemente = spärlich
zwei Äpfel 18
- 36 Elemente = ausreichend
zwei Bananen 37
- 50 Elemente = erfüllt
zwei Birnen über
50 Elemente = überfüllt
zwei eckige Beete
großer Baum Genaue
Anzahl : 15
drei große Blumen
großer Tannenbaum
drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen
kleiner Tannenbaum
Obstbaum keine
ovales Beet mittel
(1 - 7)
schlanker Baum viel
(über 7)
C. Formale Spielmerkmale
Peripher
Subjektnahes Spiel
Subjektfernes
Spiel
Zentral
Eckenbetonung
Insel-
/ Gruppe
Rechtsbetonung
Linksbetonung
Diagonale
Spannung
Gesamte
Spielfläche
Achtlose
Rahmensprengung
Konstruktive
Rahmensprengung
Reihungen
Vertikale
Spieltendenz
Formloses Spiel
Horizontale
Spieltendenz
Umgrenzungen
Symmetriebetonung
Nur
Bausteine
Betonung
des vorderen linken Quadranten
Betonung
des hinteren linken Quadranten
Betonung
des vorderen rechten Quadranten
Betonung
des hinteren rechten Quadranten
Leerlassen einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten
Betonung der unteren Hälfte
Betonung
der oberen Hälfte
Zentrierung
D. Sonstige erfüllte
Spielmerkmale dieser Versuchsperson
·
Aggressionen
gegen Vaterfigur
·
Beziehungslosigkeit
der Puppen
·
Menschen
im Liegestuhl
·
Kranke
Menschen
·
Liegende
Menschen
·
Passive
Mutterfigur
·
Passive
Vaterfigur
E. Das
Scenotestprotokoll der Versuchsperson
Einige Figuren werden zunächst hingelegt. Baby, rosa Zwilling, kleines Mädchen, Frau im Straßenkleid. Großmutterfigur wird in den Liegestuhl gelegt, an ihre Stelle wird die Frau in Arbeitskleidung gestellt. Großmutterfigur "lacht". Arztfigur "lacht", fällt dann hin; ist traurig weil er hingefallen ist, tut weh wenn man hinfällt. Von ihr werden keine Fragen wem es am besten, schlechtesten geht beantwortet, karge bis keine Wortäußerungen.
Anlage C
1. Berechnung des
Chi-Quadrat Wertes nach dem Chi-Quadrat-Vierfeldertest:
Beispiel:
Spielmerkmal: "Klo-Stuhl"
|
Spielmaterial |
gespielt / nicht
gespielt |
Enkopretiker |
Vergleichsgruppe |
Summe |
|
Klo-Stuhl |
|
|
|
|
|
|
gespielt |
9 |
21 |
30 |
|
|
nicht gespielt |
19 |
39 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe |
28 |
60 |
88 |
Berechnung:
Erwartungswerte: Diff. Beob. - Erwart.wert: Differenz2: Diff ÷ Erw.wert :
a = 9,5454 -
0,5454 0,2974 0,0311
b = 18,4545 +0,5455 0,2975 0,0161
c = 20,4545 +0,5455 0,2975 0,0145
d = 39,5454 -
0,5454 0,2974 0,0075
Chi2 -1 Wert= 0,0692
2. Berechnung des Chi-Quadrat Wertes nach Kullbacks 2 î-Test
Beispiel:
Spielmerkmal:
"Reihungen"
|
Spielmerkmal |
gespielt / nicht
gespielt |
Enkopretiker |
Vergleichsgruppe |
Summe |
|
Reihungen |
|
|
|
|
|
|
gespielt |
2 |
5 |
7 |
|
|
nicht gespielt |
26 |
78 |
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe |
28 |
83 |
111 |
Berechnung:
- gemäß Tabelle (s.h. nächste
Seite) werden den beobachteten Ergebnissen und der Gesamtsumme bestimmte Werte
zugeteilt und diese addiert.
- 2 = 2,773; 26 = 169,421; 5 =
16,094; 78 = 679,647; 111 = 1.045,516
=
1.913,451
- gemäß Tabelle werden den
Randsummen entsprechende Werte zugeteilt und addiert.
- 28 = 186,603; 83 = 733,528; 7 =
27,243; 104 = 966,033
=
1.913,407
- die zu bildende Differenz
ergibt den Chi2-2
Wert = 0,044
"Hiermit versichere ich, daß
ich diese Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe."
Stuhr-Brinkum, den 11.12.1995
____________________
( Ralf Linke )